Es war dieser eine Nachmittag in Batumi, Georgien. Draußen rauschte das Schwarze Meer, die Sonne blendete matt durch die schmutzigen Fensterscheiben – und in mir war nur Leere. Kein Schmerz, keine Tränen. Nur eine lähmende Gleichgültigkeit. Ich lag auf dem Bett, starrte an die Decke und dachte: „Was bringt das alles noch?“ Es war kein dramatischer Gedanke – eher ein resignierter. So, als hätte mein inneres System einfach den Stecker gezogen.
In dieser Phase war ich nicht nur erschöpft – ich war innerlich wie verschwunden. Ich ignorierte Mails, Aufträge, Verabredungen. Menschen, die mir viel bedeuteten, verstand ich wegzustoßen – nicht aus Absicht, sondern aus Überforderung. Ich tauchte ab, ohne Vorwarnung. Und obwohl ich wusste, dass ich mich gerade selbst sabotiere, konnte ich nicht anders. Es fühlte sich an wie ein innerer Totalausfall. Und ich spürte: Wenn ich nicht bald einen Weg aus der Depression finde, verliere ich mich selbst – diesmal vielleicht endgültig.
Das Erschreckende daran war: Ich hatte schon so viel über Heilung gelernt. Ich hatte mehrere stationäre Aufenthalte hinter mir, hatte meine Leidenschaft zur Berufung gemacht, viel gelesen, meditiert, gecoacht. Jahrelang glaubte ich, das Schlimmste hinter mir zu haben. Ich dachte, ich hätte es „überwunden“. Und doch lag ich da – regungslos, leer, gleichgültig. Der Satz „Ich bin rückfällig geworden“ fühlte sich viel zu platt an. Es war eher, als hätte sich die Depression nie wirklich verabschiedet – sie war nur stiller geworden, besser getarnt.
In diesen Momenten verstand ich: Der Weg aus der Depression ist kein Ziel, das man einmal erreicht und dann „abgehakt“ hat. Es ist ein Prozess. Und manchmal ist dieser Weg so verschlungen, dass man ihn erst erkennt, wenn man ihn fast verloren hat. Diese Erkenntnis tat weh – aber sie war ehrlich. Und irgendwo tief in mir wusste ich: Wenn ich jetzt nicht hinschaue, werde ich mich weiter verlieren.
Ich schreibe diesen Artikel nicht, weil ich eine perfekte Lösung habe. Sondern weil ich weiß, wie sich diese Dunkelheit anfühlt. Und weil ich erfahren habe, dass der Weg aus der Depression nicht linear, aber möglich ist – wenn wir beginnen, radikal ehrlich mit uns selbst zu sein.
Von funktional zu verloren – wie ich mich selbst über Jahre vergessen habe
Wenn ich heute zurückblicke, war es nicht der eine große Moment, der alles ins Wanken brachte. Es war ein schleichender Prozess. Einer, der sich gut tarnte. Ich funktionierte. Tag für Tag, Woche für Woche. Ich arbeitete selbstständig, war kreativ, führte Gespräche, plante Projekte, reiste als Digitale Nomadin durch Südeuropa und Nordafrika. Nach außen wirkte vieles stabil – vielleicht sogar erfolgreich. Doch innerlich wurde es stiller. Nicht im Sinne von friedlich. Sondern wie ein Raum, in dem das Licht langsam ausgeht.
Die ersten Anzeichen übersah ich – oder besser gesagt: Ich wollte sie nicht sehen. Müdigkeit, die tiefer ging als körperliche Erschöpfung. Gedanken, die immer wieder im Kreis liefen. Eine Stimme, die fragte: „Was ist eigentlich der Sinn von alldem?“ Ich erklärte mir das als normale Schwankungen. Sagte mir: „Das geht vorbei.“ Doch es ging nicht vorbei. Im Gegenteil: Die Leere wurde größer. Und mit ihr das Gefühl, dass ich mich selbst verliere – Stück für Stück.
Ich glaubte lange, ich hätte den Weg aus der Depression schon hinter mir. Immerhin hatte ich jahrelang an mir gearbeitet. Therapie, Selbsthilfe, Achtsamkeit, Spiritualität – ich war nicht naiv, ich war engagiert. Doch was ich übersah: Ich war auf einem Fluchtweg. Nicht vor der Welt – sondern vor mir selbst. Ich hatte gelernt, die richtigen Worte zu finden. Gelernt, zu überleben. Aber ich hatte nicht gelernt, wirklich hinzuschauen. Und so wurde aus dem Funktionieren eine Falle. Ich lebte – aber ich fühlte kaum noch.
Besonders bitter war der Moment, in dem mir klar wurde: Ich hatte nicht nur mich selbst aus den Augen verloren, sondern auch die Menschen, die mir wichtig waren. Ich war nicht mehr erreichbar – emotional, geistig, manchmal sogar physisch. Nachrichten blieben unbeantwortet, Anrufe ignoriert. Und obwohl ich das bemerkte, schaffte ich es nicht, etwas daran zu ändern. Es war, als hätte mich eine innere Mauer vom Leben getrennt – und ich wusste nicht, wie ich sie wieder einreißen sollte.
Der Weg aus der Depression beginnt oft nicht mit einem Schritt – sondern mit der Erkenntnis, dass man überhaupt verloren gegangen ist. Dass man nicht mehr fühlt, nicht mehr verbunden ist, nicht mehr weiß, wer man eigentlich ist. Diese Erkenntnis tut weh. Und sie macht Angst. Aber sie ist der Anfang. Denn erst, wenn wir sehen, wie weit wir uns entfernt haben, können wir entscheiden, ob wir zurückfinden wollen. Und ob wir bereit sind, uns dabei wirklich selbst zu begegnen.
Radikale Ehrlichkeit in der Dunkelheit – und ein Netflix-Moment, der alles veränderte
Es gibt Momente im Leben, da reicht ein einziger Impuls, um etwas in Bewegung zu bringen – auch wenn außen alles stillsteht. Für mich kam dieser Impuls aus einer unerwarteten Ecke: einer Netflix-Serie. Während meiner schwersten Phase in Batumi lag ich tagelang auf der Couch, kaum fähig aufzustehen, geschweige denn irgendetwas Sinnvolles zu tun. In meiner Apathie begann ich, die ersten beiden Staffeln von „Haus des Geldes“ zu schauen. Was zuerst wie Eskapismus wirkte, wurde plötzlich zu einem Spiegel.
Ich beobachtete, wie die Figuren – inmitten von Chaos, Angst und Eskalation – immer wieder eines taten: Sie sprachen miteinander. Offen. Direkt. Ohne Masken. Und obwohl sie teilweise in Lebensgefahr waren, waren sie emotional präsenter als ich es seit Monaten war. Diese Dialoge, diese Konfrontationen mit sich selbst und anderen, wirkten wie ein inneres Echo. Ich spürte plötzlich: Ich habe mich nicht nur von der Welt abgekapselt – ich habe aufgehört, mit mir selbst zu sprechen. Ich habe aufgehört, ehrlich hinzusehen.
In dieser dunklen Phase streckte mir dann jemand die Hand entgegen, mit dem ich früher beruflich zu tun hatte. Ein ehemaliger Auftraggeber, der offenbar spürte, dass da etwas nicht stimmte. Seine Nachricht war kein therapeutisches Angebot, kein Versuch, mich zu retten – sondern ein ehrlicher, menschlicher Kontakt. Und genau das machte es möglich: Nach viel innerem Ringen nahm ich seine Hilfe an. Und zum ersten Mal war ich radikal ehrlich. Ihm gegenüber. Und vor allem: mir selbst.
Ich schrieb es aus mir raus: Dass ich nicht mehr funktioniere. Dass ich mich verloren habe. Dass ich glaube, in einer depressiven Episode zu stecken, die tiefer geht als je zuvor. Dieser Moment war beängstigend – aber auch befreiend. Denn ich hörte auf, mir selbst etwas vorzumachen. Und in genau diesem Moment begann mein echter Weg aus der Depression.
Was ich dort in der Dunkelheit erkannt habe? Dass der Weg aus der Depression nicht immer mit Aktion beginnt, sondern mit Anerkennung. Mit der Erlaubnis, sich einzugestehen, dass man gerade nicht kann. Dass es nichts bringt, sich weiter zu zwingen, zu lächeln, zu arbeiten, zu „funktionieren“. Dass Heilung nicht bedeutet, sofort „besser“ zu werden – sondern sich überhaupt wieder zu spüren.
Der Weg aus der Depression führte mich in diesem Moment nicht ins Licht, sondern tiefer in die Nacht. Aber diesmal blieb ich dort nicht allein. Ich erlaubte mir, zu schreiben, zu fühlen, zu schweigen. Ich begann, wieder Fragen zu stellen, statt Antworten zu erzwingen. Und ich begriff: Meine Dunkelheit ist kein Zeichen von Schwäche. Sie ist ein Teil meines Weges. Und genau dort, wo alles in mir zu bröckeln schien, fand ich etwas, das ich lange verloren geglaubt hatte – Verbindung.
Verbindung zu mir selbst. Zu einem anderen Menschen. Zu dem Mut, noch einmal anzufangen. Nicht, um zu „funktionieren“, sondern um zu fühlen. Um ehrlich zu sein. Und um den nächsten Schritt zu gehen – nicht perfekt, aber echt. Denn manchmal beginnt der Weg aus der Depression genau dort, wo wir aufhören, uns zu verstecken.
Mein Weg aus der Depression begann nicht mit einem Plan – sondern mit einem Satz: „Ich kann so nicht weitermachen.“
Es gab keinen fertigen Plan. Keine To-do-Liste. Kein „Ab heute wird alles anders“. Mein Weg aus der Depression begann mit etwas viel Unspektakulärerem: einem stillen, fast beschämten Eingeständnis. Ich saß auf der Couch, das Meer rauschte draußen, und ich sagte leise zu mir selbst: „Ich kann so nicht weitermachen.“ Nicht aus Panik. Sondern aus einer tiefen Müdigkeit, die endlich gesehen werden wollte.
Was folgte, waren keine Heldentaten. Es waren kleine Bewegungen. Der Austausch via Mail mit meinem früheren Auftraggeber, das mehr war als beruflicher Austausch – es war menschliche Nähe, ohne Erwartungen. Dieses erste ehrliche Aussprechen dessen, was ich bisher verdrängt hatte, war vielleicht der mutigste Moment meines Lebens. Es war der erste Schritt auf meinem Weg aus der Depression, auch wenn ich das damals noch nicht so nennen konnte.
Ich begann wieder zu schreiben – nicht, um etwas zu produzieren, sondern um mir selbst zuzuhören. Journaling wurde mein sicherer Raum. Nicht immer regelmäßig, nicht immer klar – aber echt. Gedankenfetzen, Ängste, Erinnerungen. Ich schrieb mir die Dunkelheit von der Seele. Und manchmal, ganz selten, kam ein Lichtstrahl dazwischen. Ein Satz, der sich tröstlich anfühlte. Ein Gedanke, der nicht gegen mich war.
Auch die Stille half mir. Keine Stille, die drückt – sondern die, die trägt. Spaziergänge am Meer, Momente auf der Couch ohne Musik, ohne Ablenkung. Nur ich, mein Atem, mein Körper. Ich lernte, wieder zu spüren. Nicht immer angenehm. Aber ehrlich. Mein Weg aus der Depression verlief nicht linear – er war ein Kreislauf aus Rückzug, Reflexion, kleinen Versuchen und neuen Rückschlägen.
Ein besonderer Moment war, als ich das erste Mal öffentlich über meine Depression sprach. Auf Facebook, in einem ehrlichen, verletzlichen Beitrag. Ich hatte Angst. Doch das Echo war überraschend warm. Ich erkannte: Mein Weg aus der Depression muss kein einsamer sein. Es gibt Menschen, die verstehen. Die nicht bewerten. Die da sind. Und allein dieses Wissen veränderte etwas in mir.
Heute weiß ich: Mein Weg aus der Depression ist noch nicht zu Ende. Vielleicht wird er das nie sein. Aber ich gehe ihn. Schritt für Schritt. Und jeder Schritt, der ehrlich ist, zählt mehr als jeder Versuch, perfekt zu sein.
Was ich heute anders sehe – 5 Erkenntnisse auf meinem Weg aus der Depression
Der Weg aus der Depression hat mich verändert. Nicht über Nacht, nicht in einem Aha-Moment – sondern in vielen kleinen Erkenntnissen, die sich erst rückblickend zusammensetzen. Heute möchte ich fünf davon mit dir teilen. Nicht als Anleitung, sondern als Einladung zur Reflexion.
1. Heilung beginnt mit radikaler Ehrlichkeit
Lange glaubte ich, meine Vergangenheit bewältigt zu haben. Ich war überzeugt, meine Geschichte sei abgeschlossen. Doch tief in mir war vieles nur verdrängt, nicht verarbeitet. Erst in der dunkelsten Phase, als ich mir selbst eingestand, dass ich nicht „drüber weg“ war, begann mein echter Weg aus der Depression. Diese radikale Ehrlichkeit tat weh – doch sie öffnete den Raum für Veränderung. Solange ich mir selbst etwas vormachte, blieb ich gefangen. Der erste echte Fortschritt kam nicht durch Methoden oder neue Tools, sondern durch ein inneres Ja zu meiner eigenen Wahrheit. Und dieses Ja war der Wendepunkt.
2. Verantwortung ist kein Urteil – sondern der Beginn von Freiheit
Ich wartete lange darauf, dass äußere Umstände sich ändern. Dass Menschen sich entschuldigen. Dass Medikamente wirken. Doch mein Weg aus der Depression begann, als ich begriff: Niemand außer mir kann diese Schritte gehen. Verantwortung übernehmen heißt nicht, die Schuld für alles zu tragen – sondern sich selbst ernst zu nehmen. Es bedeutet, das Steuer zurückzuholen. Nicht als Druck, sondern als Würdigung meiner eigenen Kraft. Auch diese Erkenntnis war schmerzhaft und zugleich befreiend: Ich bin nicht machtlos. Ich bin nicht verloren. Ich darf entscheiden, was ich daraus mache.
3. Selbstreflexion ist wichtig – aber nicht alles
Ich habe viel geschrieben, analysiert, gefühlt. Doch irgendwann erkannte ich: Ich drehe mich im Kreis. Mein Weg aus der Depression brauchte nicht nur Innenschau – sondern auch ein Gegenüber. Einen Menschen, der mich spiegelt. Einen Blick von außen, der liebevoll und klar ist. Ob Therapeut, Coach oder ein vertrauter Mensch: Manche Themen können wir nicht alleine halten. Nicht, weil wir schwach sind – sondern weil wir Menschen sind. Und weil es manchmal heilend ist, gesehen zu werden, ohne sich erklären zu müssen.

4. Der Weg aus der Depression ist ein Marathon, kein Sprint
Ich wollte oft, dass es schnell geht. Dass nach der Einsicht die Leichtigkeit kommt. Doch das ist eine Illusion. Mein Weg aus der Depression ist ein langer, verschlungener Weg – mit Rückschritten, Pausen, Umwegen. Und das ist okay. Heilung ist nicht linear. Manchmal braucht es Rückzüge, Stille, Wiederholung. Heute nehme ich mir diesen Raum. Ich erlaube mir, nicht „fertig“ zu sein. Und genau das gibt mir Kraft: zu wissen, dass ich unterwegs bin. Nicht perfekt – aber in Bewegung.
5. Rückschritte sind kein Scheitern – sondern Chancen zur Vertiefung
Früher fühlte sich jeder Rückfall wie ein Beweis meines Versagens an. Heute sehe ich: Rückschritte gehören dazu. Sie zeigen mir, wo noch Schmerz sitzt, wo Muster wieder greifen. Und sie bieten mir die Chance, tiefer zu gehen. Anders zu reagieren als früher. Mein Weg aus der Depression wurde erst dann stabiler, als ich aufhörte, Rückschritte zu verurteilen. Sie sind kein Ende – sondern ein Teil des Weges. Ein Echo, das mich erinnert: Ich bin noch unterwegs. Und das ist genug.
Manche dieser Learnings kamen leise. Andere brachen wie Wellen über mich herein. Doch sie alle prägen meinen Weg aus der Depression – jeden Tag neu. Und vielleicht spürst du beim Lesen: Auch dein Weg darf ehrlich, unperfekt und menschlich sein.
Im nächsten Abschnitt zeige ich dir, wie sich mein Alltag verändert hat – nicht perfekt, aber greifbar. Wie mein Weg aus der Depression heute aussieht – mitten im Leben.
Es muss nicht perfekt sein – nur echt
Mein Weg aus der Depression hat mich verändert. Nicht zu einem „neuen Menschen“, nicht zu einer besseren Version von mir – sondern zu jemandem, der sich selbst besser versteht. Der sich erlaubt, Fragen zu stellen, statt sofort Antworten zu haben. Der leise geworden ist – aber nicht schwach. Der wieder spürt, was ihn berührt. Mein Alltag ist heute kein Happy End – aber er ist echter. Aufrichtiger. Langsamer.
Ich stehe morgens nicht immer mit Leichtigkeit auf – aber mit Bewusstsein. Ich schreibe. Ich höre hin. Ich ziehe mich manchmal zurück, aber nicht mehr, um zu verschwinden – sondern um mich zu sortieren. Mein Weg aus der Depression ist nicht abgeschlossen. Vielleicht wird er das nie sein. Aber er ist mein. Und er fühlt sich inzwischen nach Leben an – nicht nur nach Überleben.
Wenn du dich gerade selbst irgendwo auf diesem Weg befindest – zwischen Rückzug und Hoffnung, zwischen Zweifel und Mut – dann möchte ich dir eines sagen: Du bist nicht allein. Vielleicht kennst du mich nicht persönlich. Vielleicht hast du nur diesen Text gelesen. Aber wenn dich etwas darin berührt hat, dann gibt es da schon jetzt eine Verbindung.
Und falls du spürst, dass dir leise Impulse guttun würden – Gedanken, die dich erinnern, dass du nicht kaputt bist, sondern einfach menschlich – dann lade ich dich von Herzen ein:
👉 Melde dich für meinen Newsletter an.
Ich schreibe ihn so, wie ich selbst gern gelesen werden möchte: ehrlich, verletzlich, ohne Druck. Worte für Tage, an denen es still wird. Und für Momente, in denen du jemanden brauchst, der sagt: „Ich weiß, wie sich das anfühlt.“
Mein Weg aus der Depression war kein gerader Pfad – aber er war nie umsonst. Vielleicht, weil er mich genau hierher geführt hat: zu dir. Und vielleicht ist das, was jetzt beginnt, ein gemeinsames Stück Weg.
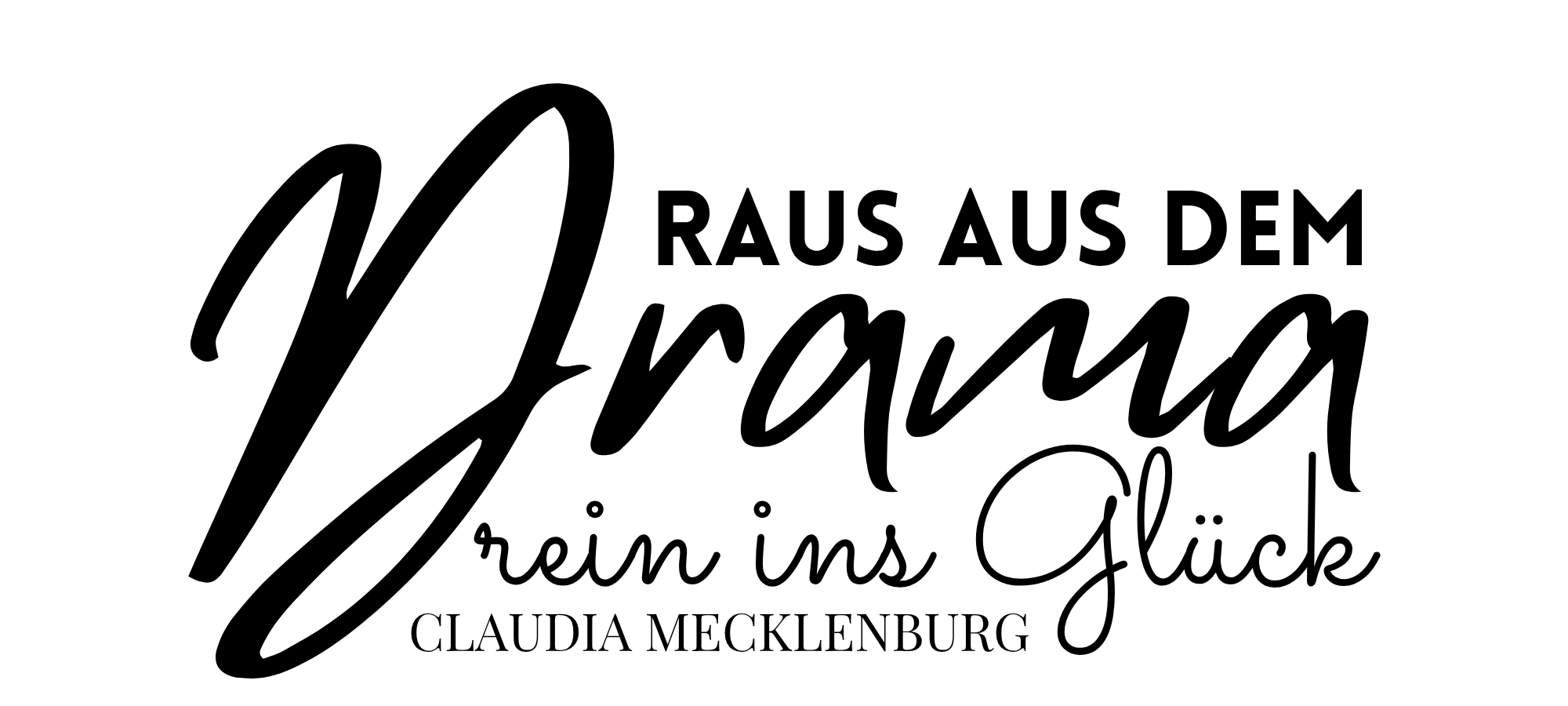







0 Kommentare