Man sieht es mir nicht an. Ich habe funktioniert, gelächelt, geleistet – obwohl in mir längst nichts mehr ging. Funktionieren trotz Depression war mein Alltag, mein Schutz, mein Gefängnis. In diesem Text teile ich ehrlich, wie es dazu kam, was es mit mir gemacht hat – und warum ich heute anders mit mir umgehe.
Funktionieren bis zur Erschöpfung
Es gab diesen einen Abend, an dem ich auf dem Sofa saß – starr, erschöpft, innerlich leer. Die Wohnung war still, das Licht gedämpft, irgendwo im Hintergrund lief Musik, die ich nicht wirklich hörte. Mein Handy vibrierte. Eine Nachricht von einer Freundin: „Wie geht’s dir?“ Ich starrte auf den Bildschirm, mein Daumen schwebte über den Buchstaben. Doch ich konnte nicht antworten. Nicht, weil ich nicht wollte – sondern weil ich es selbst nicht wusste.
Wie geht’s dir?
Eine einfache Frage. Und gleichzeitig eine, auf die ich keine ehrliche Antwort mehr hatte. Ich funktionierte. Irgendwie. Ich stand morgens auf, erledigte meine To-Dos, lächelte in Meetings, ging spazieren, kochte mir Essen. Es sah aus wie Leben. Doch es fühlte sich nicht so an.
Dieses Funktionieren trotz Depression war mein Alltag geworden – lange, bevor ich es überhaupt so nennen konnte. Ich hatte keine Diagnose, keine Therapie, keine Worte für das, was da in mir wirkte. Nur diese bleierne Schwere, die sich jeden Tag ein bisschen mehr in mein System fraß. Und das leise Gefühl: Wenn ich jetzt stehen bleibe, falle ich auseinander.
Also machte ich weiter.
Ich sagte Verabredungen ab, weil „ich so viel zu tun hatte“. Ich ignorierte die Schlaflosigkeit, die Verspannungen, die Tränen, die plötzlich kamen und genauso schnell wieder verschwanden. Ich redete mir ein, dass ich nur „eine Phase“ habe. Dass es wieder besser wird. Dass ich einfach disziplinierter sein muss. Positiver denken. Struktur reinbringen. Funktionieren.
Doch Funktionieren trotz Depression ist kein Zeichen von Stärke – es ist ein Überlebensmechanismus. Und irgendwann wird er zum Käfig. Ich spürte es immer mehr: Dieses Weiterfunktionieren hatte einen Preis. Es kostete mich meine Verbindung zu mir selbst. Zu meinen Gefühlen. Zu meiner Wahrheit.
Und doch war da auch eine Angst: Was passiert, wenn ich nicht mehr funktioniere? Wenn ich mir erlaube, ehrlich hinzusehen? Wenn ich falle?
In dieser Dunkelheit begann langsam ein neues Verständnis zu wachsen. Funktionieren trotz Depression war nicht mein Fehler. Es war meine Strategie – in einer Welt, die wenig Raum für echte Erschöpfung lässt. Aber es war nicht das, was ich wirklich wollte. Ich wollte nicht nur „durchhalten“. Ich wollte leben. Spüren. Atmen. Sein.
Und irgendwann kam der Moment, an dem ich bereit war, nicht mehr nur zu funktionieren – sondern hinzusehen.
Der Preis vom Funktionieren trotz Depressionen
Es klingt paradox: Man steht auf, macht weiter, funktioniert – und wird doch immer leerer. Lange habe ich geglaubt, dass mein Funktionieren trotz Depression eine Form von Disziplin sei. Ein Zeichen dafür, dass ich „nicht ganz so schlimm dran“ bin. Dass ich Kontrolle habe. Heute weiß ich: Es war das Gegenteil. Es war eine stille Kapitulation vor einer Welt, in der Leistung mehr zählt als Lebendigkeit.
Was niemand sieht: Funktionieren trotz Depression zehrt an dir. Nicht laut. Nicht sichtbar. Sondern langsam, leise, schleichend. Es sind nicht die großen Zusammenbrüche, die dich ausbrennen – es ist das tägliche „Weiter so“, obwohl innen längst alles schreit.
Ich erinnere mich an Tage, an denen ich auf der Arbeit war, professionell, freundlich, sogar humorvoll. Und abends brach ich in Tränen aus, ohne zu wissen warum. Ich erinnere mich an Gespräche, bei denen ich zustimmend nickte, während ich innerlich längst weg war. Ich hörte zu – aber nichts drang mehr zu mir durch.
Funktionieren trotz Depression bedeutet: Du bist da, aber nicht wirklich. Du erfüllst Rollen, aber verlierst dein Gesicht. Du lächelst, obwohl du weinst. Du sagst: „Alles gut“, weil du keine Worte hast für das Gegenteil.
Der Preis dafür ist hoch. Man verliert sich. Nicht auf einmal – sondern Stück für Stück. Ich verlor meine Spontaneität, meine Neugier, meinen Zugang zu kleinen Freuden. Ich fühlte mich fremd in meinem eigenen Leben. Und schlimmer noch: Ich begann zu glauben, dass das normal sei.
Ich machte mir Vorwürfe. Warum war ich so müde? Warum konnte ich mich nicht einfach „zusammenreißen“? Warum klappte bei mir nicht, was bei anderen doch scheinbar so leicht ging?
Diese Selbstverurteilung, diese ständige innere Anklage – sie war vielleicht der schwerste Teil. Denn sie machte es unmöglich, mir selbst Mitgefühl zu schenken. Ich war nicht nur erschöpft – ich fühlte mich auch schuldig dafür.
Erst viel später habe ich verstanden: Wer funktioniert trotz Depression, lebt oft in zwei Welten. Außen die Fassade – innen das Chaos. Und irgendwann kommt der Moment, an dem beides nicht mehr zusammenpasst.
Bei mir war dieser Moment kein lauter Knall. Es war ein leiser Riss. Ein Gedanke, der zum ersten Mal nicht weggedrückt wurde: Vielleicht darf ich aufhören, so stark zu tun.
Was mich lange gehalten – und gleichzeitig erschöpft hat
Es gibt Dinge, die uns scheinbar Halt geben. Routinen, Rollen, Strukturen. Sie geben uns ein Gefühl von Kontrolle – besonders dann, wenn innen alles aus den Fugen gerät. Auch ich hatte solche Anker. Und lange Zeit dachte ich, sie seien meine Rettung.
Morgens früh aufstehen, obwohl ich kaum geschlafen hatte. Sporteinheiten, um mich zu „spüren“. To-Do-Listen, die mich durch den Tag trugen wie ein Automat. Ich war organisiert, verlässlich, leistungsfähig. Für andere wirkte ich stabil – dabei hielt ich mich nur irgendwie zusammen. Nicht aus Stärke. Sondern aus Angst.
Denn wenn ich stehen blieb, drohte der Boden unter mir zu zerbröckeln. Also hielt ich fest. An Disziplin. An Funktion. An einem Bild von mir, das nicht stimmte. Funktionieren trotz Depression wurde mein Lebensstil – und meine Falle.
Ich redete mir ein, dass Struktur mir guttut. Dass Routinen heilsam sind. Und das stimmt auch – bis zu dem Punkt, an dem sie zur Maske werden. Meine Rituale waren nicht Ausdruck von Selbstfürsorge, sondern Überlebensstrategie. Ich meditierte nicht, um mir zu begegnen – sondern um mich zu beruhigen, damit ich wieder „funktioniere“. Ich journallte nicht, um zu fühlen – sondern um Ordnung ins Chaos zu bringen, das ich eigentlich nicht fühlen wollte.
Auch meine Rollen hielten mich: Die Zuverlässige. Die Funktionierende. Die, die „immer irgendwie klarkommt“. Ich bekam Anerkennung dafür. Lob. Respekt. Und gleichzeitig fühlte ich mich immer einsamer. Denn niemand sah, wie sehr ich mich selbst dabei verlor.
Funktionieren trotz Depression bedeutet oft auch: Du baust dir ein System, das dich stabil hält – während es dich leise zermürbt. Ich bemerkte das erst, als ich nicht mehr konnte. Als mein Körper streikte. Als der Schlaf ausblieb, die Gedanken lauter wurden, mein Lächeln schwerer.
Was mich lange gehalten hatte, erschöpfte mich irgendwann. Und ich stand vor der Frage: Was bleibt, wenn ich loslasse? Wer bin ich, wenn ich nicht mehr die Starke bin?
Es war beängstigend, das alles zu hinterfragen. Und doch war es notwendig. Denn wahre Heilung beginnt nicht mit noch mehr Disziplin – sondern mit dem Mut, ehrlich anzunehmen, was wirklich da ist.
Was ich heute anders mache
Es hat gedauert, bis ich mich getraut habe, anders zu leben. Nicht von heute auf morgen. Nicht in einem mutigen Befreiungsschlag. Sondern langsam. Zögerlich. Und manchmal rückfällig. Aber Schritt für Schritt habe ich begonnen, mein inneres System umzuprogrammieren – weg vom reinen Funktionieren trotz Depression, hin zu einem Leben, das sich wieder wie meins anfühlt.
Heute frage ich mich nicht mehr zuerst: Was muss ich schaffen?
Sondern: Was brauche ich gerade wirklich?
Dieser eine Satz hat vieles verändert. Ich habe gelernt, ihn mir leise zu stellen – morgens, wenn ich aufwache, abends, wenn ich zurückschaue, und zwischendurch, wenn alles zu viel wird. Er ist wie ein innerer Kompass geworden. Einer, der mich nicht antreibt – sondern begleitet.
Ich mache heute vieles langsamer. Nicht, weil ich faul geworden bin. Sondern weil ich gelernt habe, dass mein Nervensystem keinen Druck braucht, sondern Sicherheit. Ich habe aufgehört, meine Produktivität mit meinem Wert zu verwechseln. Und ich habe mir erlaubt, Pausen nicht zu rechtfertigen.
Funktionieren trotz Depression war lange mein Automatismus. Heute ist es meine Entscheidung, nicht mehr nur zu funktionieren. Ich arbeite noch immer. Ich bin aktiv. Ich engagiere mich. Aber ich tue es mit mehr Bewusstheit. Mit mehr Spielraum für meine Grenzen. Ich sage Nein, auch wenn es mir schwerfällt. Ich sage Ja – zu mir, zu meinen Bedürfnissen, zu meinem Tempo.
Ein paar konkrete Dinge, die ich verändert habe:
- Journaling nicht mehr als Leistung, sondern als liebevollen Spiegel: Keine perfekten Formulierungen mehr. Manchmal nur ein Satz. Manchmal Tränen auf dem Papier.
- Pausenräume schaffen, bevor sie nötig sind: Eine Tasse Tee am Fenster. Fünf Minuten Musik. Kein „Scrollen“, sondern Stille.
- Verbindung ohne Maske: Ich gehe offen mit dem Thema um – auch auf Social Media. Ich rede heute ehrlicher mit Menschen, denen ich vertraue. Nicht dramatisch – sondern echt. „Mir geht’s gerade nicht gut“ ist ein ganzer Satz. Und er ist genug.
Ich weiß heute: Es geht nicht darum, nie wieder zu funktionieren. Es geht darum, bewusst zu wählen, wann ich etwas tue – und wann ich mir erlaube, einfach zu sein.
Denn das ist vielleicht der größte Unterschied: Ich lebe nicht mehr gegen mich. Ich lebe mit mir. Auch an den dunklen Tagen. Gerade dann.
Funktionieren trotz Depression – und was du dich selbst fragen darfst
Vielleicht liest du diesen Text und spürst ein leises Nicken in dir. Vielleicht erkennst du dich in manchen Zeilen wieder – in der Müdigkeit, im inneren Druck, im unaufhörlichen Weiterlaufen. Und vielleicht bist du – so wie ich damals – an einem Punkt, an dem du spürst: So kann es nicht weitergehen. Aber du weißt nicht, wo du anfangen sollst.
Dann möchte ich dir heute keine Lösung geben. Sondern eine Einladung.
Funktionieren trotz Depression ist oft ein Überlebensmodus. Einer, der dich geschützt hat. Einer, der dich durchgebracht hat. Und trotzdem darfst du dich fragen: Was würde sich verändern, wenn du diesen Schutz langsam, sanft, hinterfragst?
Hier sind drei Reflexionsfragen, die dir helfen können, dich selbst wieder ein Stück näher zu kommen:
🖊 1. In welchen Momenten spüre ich, dass ich nur noch funktioniere – aber nicht mehr wirklich da bin?
→ Versuche, diese Situationen aufzuschreiben. Nicht um sie zu bewerten, sondern um sie sichtbar zu machen. Bewusstheit ist der erste Schritt.
🖊 2. Was brauche ich in diesen Momenten eigentlich – körperlich, emotional, seelisch?
→ Nicht: Was sollte ich tun. Sondern: Was wünsche ich mir still in mir? Manchmal ist es Ruhe. Manchmal ist es Nähe. Manchmal ein ehrlicher Satz.
🖊 3. Was wäre ein kleiner, liebevoller Schritt – weg vom Funktionieren, hin zum Spüren?
→ Vielleicht ein bewusstes Innehalten. Ein ehrliches Gespräch. Ein Spaziergang ohne Podcast. Ein einziger Satz im Journal.
Du musst dein Leben nicht sofort verändern. Du musst nicht alles verstehen. Und schon gar nicht „funktionieren“. Es reicht, wenn du beginnst, hinzusehen. Sanft. Ehrlich. In deinem Tempo.
Denn tief in dir weißt du: Du bist nicht dafür gemacht, dich selbst zu verlieren. Du bist dafür gemacht, dich wiederzufinden. Schritt für Schritt. Auch – und gerade – mitten in der Dunkelheit.
Du darfst anders – du darfst echt
Vielleicht hast du zu oft gehört, dass du „stark bleiben musst“. Dass du einfach „dranbleiben“, „positiv denken“ oder „dankbar sein“ sollst. Und vielleicht hast du es versucht. Immer wieder. So wie ich. Funktioniert, gelächelt, durchgezogen – obwohl innen alles schrie.
Aber was, wenn du nicht versagt hast – sondern nur vergessen hast, wie es sich anfühlt, echt zu sein?
Funktionieren trotz Depression ist kein Makel. Es ist ein Zeichen dafür, dass du lange durchgehalten hast. Dass du versucht hast, deinen Weg zu gehen in einer Welt, die kaum Raum lässt für Erschöpfung, Zweifel oder leise Not.
Doch du darfst dich entscheiden, anders zu leben. Du darfst dich entscheiden, nicht perfekt zu funktionieren – sondern dich liebevoll zu begleiten. Schritt für Schritt. Ohne Ziel, aber mit Richtung: zurück zu dir.
Und wenn du magst, möchte ich dir dabei etwas mitgeben.
👉 Mein kostenloses Mini-e-Book „7 kraftvolle Journaling-Übungen, um depressive Gedanken zu überwinden“ ist genau für solche Momente gedacht. Kein Druck. Keine Lösung. Sondern kleine Impulse, die dich erinnern dürfen: Du bist nicht allein. Und du bist nicht falsch, so wie du fühlst.
Wenn du das Gefühl hast, dass dich das gerade unterstützen könnte –
du findest es hier

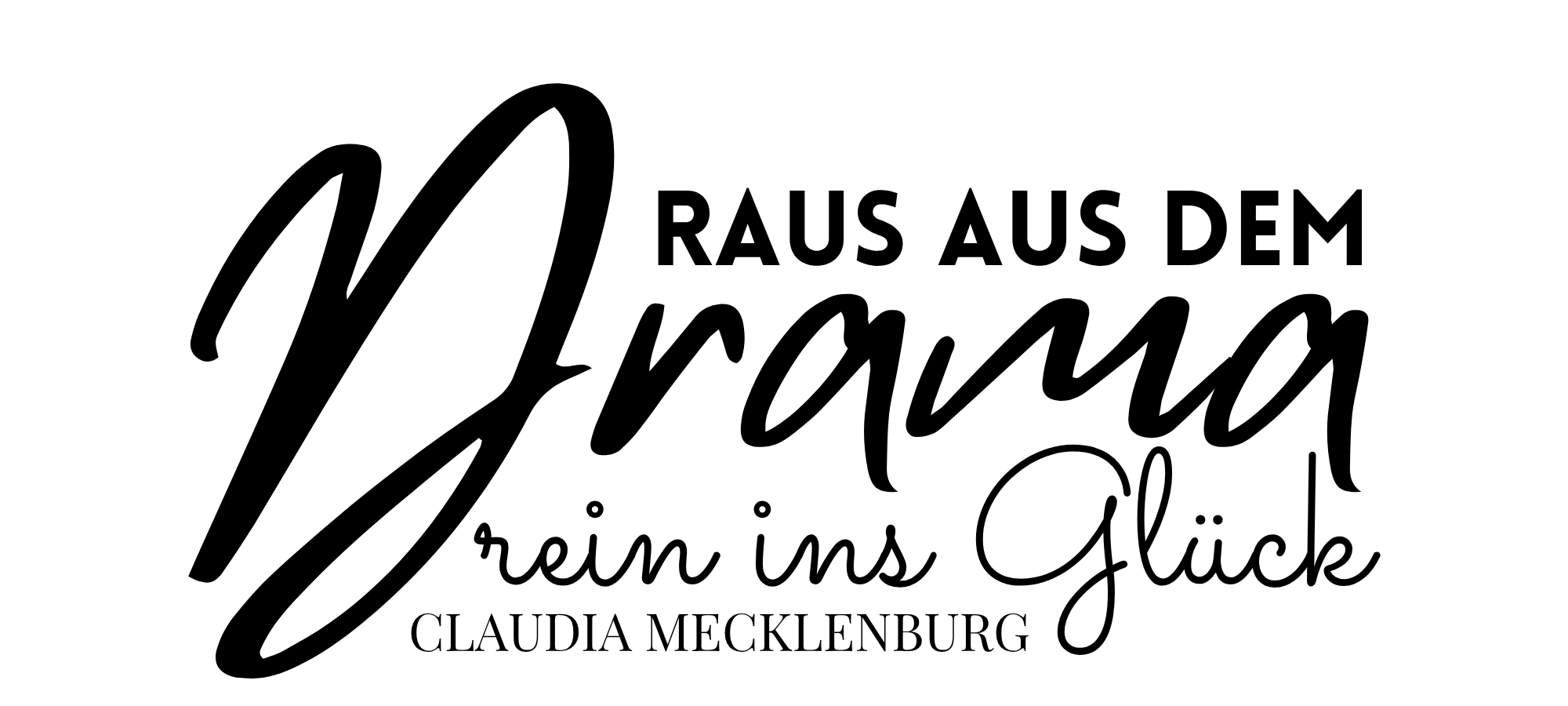







0 Kommentare